© 2025 Projektwerkstatt GmbH
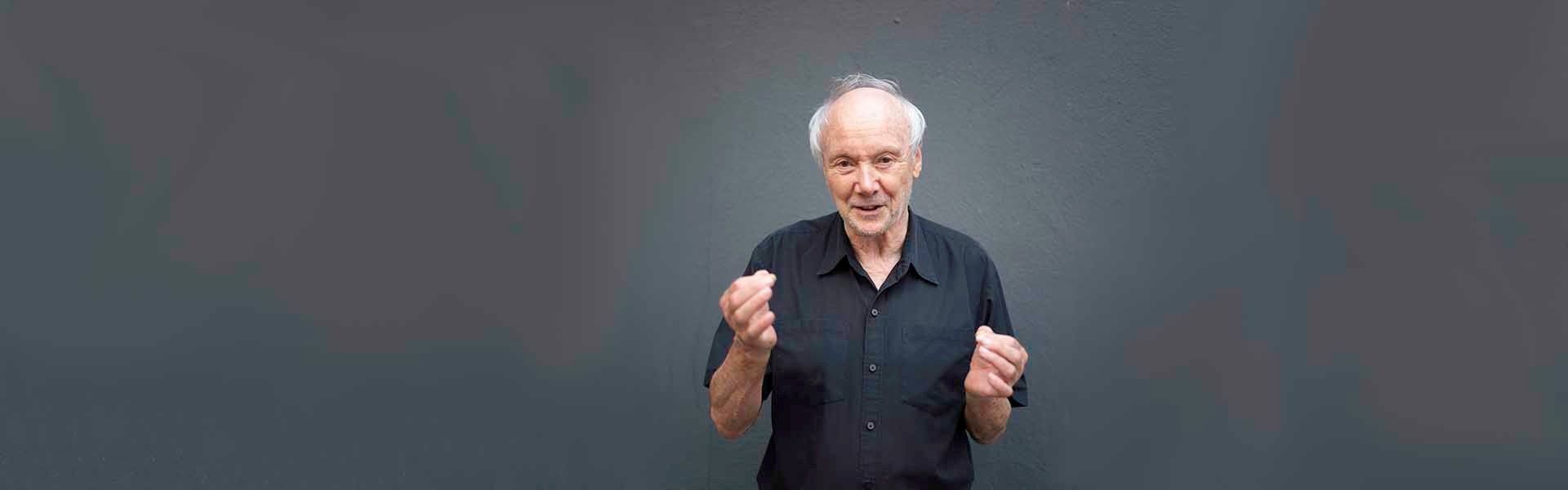
Zur Geschichte der Teekampagne
Wie man hervorragenden Tee, niedrigen Preis, Fairness zu Mensch und Natur unter einen Hut bringt.
von Günter Faltin
Was macht Tee so teuer?
Auf Reisen in Entwicklungsländer war mir aufgefallen, dass Produkte wie Kaffee, Bananen, Zucker, Tee bei uns ungefähr zehnmal mehr kosten als dort. Was macht die Produkte bei uns derart teuer? Und warum war gerade Tee in Deutschland exorbitant teuer, selbst im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Lag es an den Frachtkosten, der Versicherung oder etwa den hohen Gewinnspannen der Kaufleute?
Nach eingehender Recherche stellte sich heraus: Teuer machen den Tee nicht etwa diese Kosten, sondern die zahlreichen Stufen des Zwischenhandels und die handelsüblichen Kleinpackungen. Vom Tor der Teeplantage fährt der Tee zum Exporteur, wird zum Importeur verschifft, von dort auf Paletten zum Großhändler gefahren und landet schließlich beim Einzelhändler im Teeladen. Viele Transportwege, jedes Mal neu verpackt.
Kann man das intelligenter organisieren? Nicht, wenn man einen konventionellen Teeladen betreibt. Wer ein breites Sortiment an Teesorten anbieten will, kommt an der Kette der Zwischenhändler nicht vorbei. Also, den Zwischenhandel umgehen und kostengünstigere größere Packungen anbieten?
Wie kann man den Zwischenhandel ausschalten?
Ein verrückter Gedanke blitzt auf. Wenn man radikal vereinfacht und nur eine einzige Teesorte anbietet – könnte man dann nicht große Einkaufsmengen generieren und direkt bei den Erzeugern einkaufen?
Es würde zu erheblichen Einsparungen führen. Werden Kunden sich damit zufrieden geben, nur eine einzige Teesorte kaufen zu können? Warum nicht, wenn man ihnen eine bekannte, sehr hochwertige Teesorte anbietet.
Tee ganz anders handeln, als üblich? Das schien mir sinnvoll. Aber warum tat das niemand?
Die Geburtsstunde der Teekampagne
Mitte der 1980er Jahre ist es soweit. Ich bin Hochschullehrer an der Freien Universität Berlin, am Institut für Wirtschaftspädagogik.
Eigentlich ein geeigneter Ort für ein ökonomisches Experiment.
Meine Studenten zweifeln, als ich das Konzept zum ersten Mal vortrage. Zu verrückt, keine Aussicht auf Erfolg.
Typisch Professor, von Praxis keine Ahnung.
Aber später zieht eine Handvoll von Studenten mit. Die Teekampagne nimmt Gestalt an.
Fairer Handel und Chemierückstände
Von Anfang an hatten wir noch zwei weitere Aspekte im Blick:
Fairer Handel und Chemierückstände in Lebensmitteln sind Themen, die an der Universität diskutiert werden, aber ohne Relevanz für die Praxis draußen bleiben. Auch das wollen wir ändern.
Wer fair mit den Erzeugern handelt, muss beim Einkauf mehr für den Tee bezahlen. Auch Rückstandsanalysen kosten viel Geld.
Beides zusammen würde den Tee derart verteuern – so die Überlegung – dass man bestenfalls in einer Nische weniger wohlmeinender Kunden bleibt, die gewillt sind, tief in die Tasche zu greifen. Was tun?
Direktimport und Großpackungen – das schafft die entscheidenden Einsparungen
Mit den Einsparungen durch Direktimport und dem Verzicht auf Kleinpackungen gewinnen wir den Spielraum, faire Preise zu bezahlen. Und die Kosten für Rückstandsanalysen zu kompensieren.
Nur eine einzige Teesorte und die nur in Großpackungen.
Scheinbar verrückt, aber es war vom Start weg ein Erfolg.
Bis heute.
Die Idee der Teekampagne verbreitete sich wie ein Lauffeuer.
Ein Idee mit Wirkung
Das Ergebnis ist ein ökonomisches Lehrstück:
Weil unnötige Kosten eingespart werden, können erstklassige Tees, fair gehandelt und in Bio-Qualität zu erschwinglichen Preisen angeboten werden.
Warum das wichtig ist?
Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die große Mehrheit der Kunden nicht bereit ist, für Bio- und fair gehandelte Produkte einen deutlich höheren Preis zu bezahlen.
Eine nachhaltige Ökonomie und fairer Handel werden sich nur dann flächendeckend durchsetzen, wenn für diese Produkte nicht deutlich mehr bezahlt werden muss, als für herkömmliche Produkte.
